Zum 200jährigen Jubiläum des Westfälischen Landgestüts
Bürgermeister
Johann Kaspar Schnösenberg (1786-182
Bürgermeister von 1813-1826
Vorgänger: Gerhard Limberg 1812-1813
Nachfolger: Alex Lohagen 1826-1835
von Mechtild Wolff (2026)
von Mechtild Wolff (2026)
 Es war an einem eisig kalten Februartag im Jahr 1826, als die
Warendorfer Bürger durch einen ungewöhnlich lang andauernden Hufschlag
aufgeschreckt wurden. Das Klappern von Pferdehufen gehörte damals zwar
zum Alltag, denn Pferd und Wagen waren das einzige
Transportationsmittel, aber dieses Geräusch war anders und trieb die
Bürger neugierig aus ihren Häusern. Voller Erstaunen sahen sie einen
langen Tross mit 24 Hengsten und einigen Reitern im Sattel – edle, aber
doch recht müde wirkende Pferde, gefolgt von vier schweren
Arbeitspferden. Eiligst wurde Bürgermeister Johann Kaspar Schnösenberg
im Rathaus am Marktplatz benachrichtigt, der hocherfreut zum Münstertor
eilte, wo er im erst vor 10 Jahren erbauten Kavallerie-Stall schon Boxen
für 100 Hengste hatte einrichten lassen.
Es war an einem eisig kalten Februartag im Jahr 1826, als die
Warendorfer Bürger durch einen ungewöhnlich lang andauernden Hufschlag
aufgeschreckt wurden. Das Klappern von Pferdehufen gehörte damals zwar
zum Alltag, denn Pferd und Wagen waren das einzige
Transportationsmittel, aber dieses Geräusch war anders und trieb die
Bürger neugierig aus ihren Häusern. Voller Erstaunen sahen sie einen
langen Tross mit 24 Hengsten und einigen Reitern im Sattel – edle, aber
doch recht müde wirkende Pferde, gefolgt von vier schweren
Arbeitspferden. Eiligst wurde Bürgermeister Johann Kaspar Schnösenberg
im Rathaus am Marktplatz benachrichtigt, der hocherfreut zum Münstertor
eilte, wo er im erst vor 10 Jahren erbauten Kavallerie-Stall schon Boxen
für 100 Hengste hatte einrichten lassen.

Marktplatz am Münstertor, Warendorf
Da kam der Plan des preußischen
Oberstallmeisters Carl Freiherr von Knobelsdorff gerade recht, der in
der westfälischen Provinz ein Gestüt für ausgewählte Deckhengste
einrichten wollte. Warendorf bot ideale Bedingungen, eine solide
Kleinstadt mit etwa 4000 Einwohnern, ja sogar eine Garnisonsstadt, die
mit der sandigen Umgebung ideale Reitmöglichkeiten bot und im „Großen
Stall“ am Münsterwall Platz für 100 Pferde zur Verfügung stellen konnte.
Für die Unterkunft der Gestütsknechte wurde in den umliegenden
Bürgerhäusern gesorgt. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte ein
„Königliches Landgestüt“ nach dem Vorbild von Trakehnen und Neustadt an
der Dosse geplant werden. Mit dieser Zusage schickte die Obrigkeit den
Gestütsinspektor Heinrich Köhne mit den sorgsam ausgewählten Hengsten
und einigen Pferdeknechten auf den langen und beschwerlichen Weg von
Ostpreußen nach Westfalen. Köhne war auch persönlich hocherfreut, denn
es ging zurück in seine westfälische Heimat. Bürgermeister Schnösenbergs
Plan war geglückt!
Wer war dieser Johann Kaspar Schnösenberg?
Johann
Kasper Schnösenberg war der Sohn eines Warendorfer Bäckers, Brauers und
Gastwirts, man nannte ihn auch Wirtschafter. Seine Familie führte das
wohlrenommierte Hotel Schnösenberg mit Gaststätte und großem Festsaal an
der Münsterstraße.

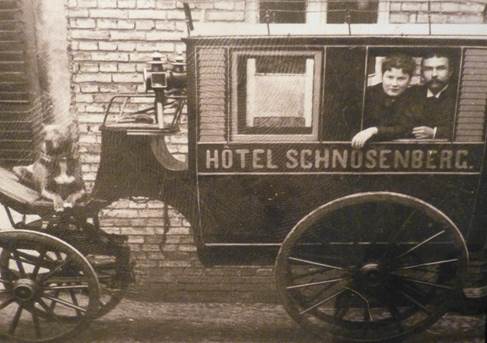
Hotel Schnösenberg mit hoteleigener Kutsche
Johann
Kaspar durfte das „Laurentianische Gymnasium“ der Franziskaner in
Warendorf besuchen und wurde als guter Schüler mehrfach ausgezeichnet.
Früh lernte er, dass sich Erfolg nur durch Fleiß und Strebsamkeit
einstellt. Im Hotel Schnösenberg war es selbstverständlich, dass alle
Familienmitglieder mit anpackten. Gern erzählte Johann Kaspar, mit
welchem Vergnügen er die Gäste mit der eleganten Kutsche des Hotels
Schnösenberg kutschierte.
Johann Kaspar Schnösenberg wird Bürgermeister
Nach der Schule lernte und arbeitete Johann Kaspar Schnösenberg
bei einem gestrengen Kaufmann. Das war eine gute Vorbereitung auf das
Bürgermeisteramt, das ihm 1813 im Alter von nur 27 Jahren anvertraut
wurde. Dieses Amt war ehrenamtlich, der Bürgermeister erhielt kein
Gehalt, aber eine Aufwandsentschädigung von 800 Talern für Bürokosten.
Ja, es konnten sich nur wohlhabende Kaufleute leisten, diesen
ehrenvollen Posten zu übernehmen. Es dauerte noch bis 1868, ehe mit
Bürgermeister Diederich ein ausgebildeter und gut besoldeter
Verwaltungsfachmann in das Bürgermeisteramt kam.

Münstertor mit Marienfelder Säulen, ein schöner Stadteingang
Bei Amtsantritt musste Bürgermeister Schnösenberg feststellen,
dass sich sein geliebtes Gymnasium im Niedergang befand. Darum sah er
seine vordringliche Aufgabe darin, „die Wiederherstellung des
Laurentianischen Gymnasii“ zu betreiben, von dem „der Flor der Stadt und
die Bildung der Jugend“ abhing, so schrieb er an die Münsterische
Behörde. Der Oberpräsidenten von Vincke unterstützte Schnösenbergs
Bestrebungen und der Bürgermeister konnte am 1. Mai 1820 die
Wiedererrichtung des Gymnasium Laurentianum als „Höhere Bürgerschule“ im
neuhumanistischen Geist bekannt geben. Das Gymnasium war gerettet.
Das Münstertor wird durch die Marienfelder Säulen verschönert
Bürgermeister Schnösenberg lag die Verschönerung des
Stadtbildes sehr am Herzen. Darum nutzte er 1823 seine guten Beziehungen
zum Preußischen König Friedrich Wilhelm III. und bat ihn, der Stadt
Warendorf die alte Toranlage der Zisterzienserabtei Marienfeld zu
überlassen. Diese Toranlage hatte bis 1803 an der Zisterzienserabtei
gestanden, dann aber war dieses prachtvolle Bauwerk im Zuge der
Säkularisierung „in Ungnade“ gefallen. Die Sandsteinsäulen waren nun
Staatseigentum und wurden abgerissen, aber Gott Dank nicht zerstört,
sondern sorgsam eingelagert. Davon bekam Bürgermeister Schnösenberg
Kenntnis und dank seiner guten Beziehungen zum Preußischen König konnte
er die acht Sandsteinsäulen nach Warendorf holen. Seit über 200 Jahren
zieren nun die Torpfeiler den westlichen Stadteingang unserer Stadt. Das
Münstertor vermittelt uns Bürgern und den Besuchern den Beginn einer
historische Altstadt - ein stilvoller Stadteingang.
Schnösenberg wurde ein tüchtiger Bürgermeister und bekam in
Anerkennung seiner Verdienste 1824 eine Zulage von 100 Talern
zugesprochen, die aus dem städtischen Kommunalfonds gezahlt wurde. Damit
wurde der Warendorfer Bürgermeister der höchstbesoldete Kommunalbeamte
im Regierungsbezirk Münster.
Die Gründung des Westfälischen Landgestüts
Am 17. Februar 1826 verwirklichte sich nach vierjähriger
Vorbereitungszeit ein Plan, dessen Wichtigkeit für Warendorf man damals
noch gar nicht abschätzen konnte. Aus Ostpreußen kam nach wochenlangem
Marsch durch Eis und Schnee ein Tross mit ausgewählten Deckhengsten in
Warendorf an. Im Kavallerie-Stall am Münsterwall hatte Bürgermeister
Schnösenberg Boxen für 100 Hengste eingerichtet - das „Königliche
Landgestüt“ nach dem Vorbild des so erfolgreichen Preußischen Gestüts in
Trakehnen war begründet. Schon zwei Tage später kam der westfälische
Oberpräsident Ludwig Freiherr von Vincke in seiner Dienstkutsche nach
Warendorf, um das neue Gestüt zu begutachten. Auf dem Wilhelmsplatz
erlebte er die „Revue der wirklich schönen Hengste, welche gewiss eine
Wohltat für die Provinz sein werden.“ Die erste „Warendorfer
Hengstparade“ des „Königlich-Preußischen Rheinisch-Westfälischen
Landgestüts“ hatte mit großem Erfolg stattgefunden! König Friedrich
Wilhelm III unterstützte die langfristige Einrichtung des Gestüts im
Warendorf, um die wenig erfreuliche Lage der Pferdezucht in Westfalen zu
verbessern. Die gestrenge Aufsicht des Gestütsinspektors Köhne zeigte
gute Erfolge. Aus der Zucht mit Gestütshengsten gingen immer mehr
„Husarenpferde“ hervor, was den guten Ruf des Warendorfer Gestüts
begründete und mit denen die Züchter gutes Geld verdienen konnten. Wegen
seiner guten Zuchterfolge wurde Heinrich Köhne zum ersten
Landstallmeister berufen. Auch Bürgermeister Schnösenberg setzte sich
nach Kräften für das Gestüt ein, denn auch er wusste, dass gute Reit-
und Zugpferde dringend gebraucht wurden. Damals hätte noch niemand
gedacht, dass Warendorf dereinst zur Stadt des Pferdes werden würde und
das Landgestüt im Jahr 2026 seinen 200. Geburtstag feiern würde – mit
160 Hengsten im Stall.
Es war tragisch, dass Bürgermeister Johann Kaspar Schnösenberg
den Aufstieg des Gestüts nicht mehr miterleben konnte. Er verstarb
völlig unerwartet im August 1826 im Alter von nur 40 Jahren. Die Stadt
Warendorf verlor allzu früh ihren tüchtigen und allseits geschätzten
Bürgermeister.
Im Schulviertel erinnert die „Schnösenbergstraße“ an diesen
tüchtigen und beliebten Bürgermeister.
Mechtild Wolff
Vor 80 Jahren: Die letzten Tage des 2. Weltkriegs in
Warendorf Ostern 1945
von Mechtild Wolff (2025)
von Mechtild Wolff (2025)

die alte Emsbrücke vor 1945
 Theo Lepper |
Alle Verantwortung für ein möglichst friedliches Kriegsende lag beim Stadtrentmeister Theodor Lepper, der seit den 1920er Jahren die Stadtkasse leitete. Er war ein verantwortungsbewusster Beamter und als geborener Warendorfer fühlte er sich seiner Heimatstadt in besonderer Weise verpflichtet. In den letzten Kriegstagen, kurz vor der alliierten Besetzung, musste er „als Rang ältester Beamter der Stadt“ die Amtsgeschäfte der Stadtverwaltung übernehmen, denn am 31. März 1945, es war Karsamstag, hatten Landrat Gerdes und Bürgermeister Haase in Sanitäter-Uniformen die Stadt fluchtartig verlassen. Auch die gesamte Polizei war geflohen. „Das Schicksal der Stadt liegt jetzt in ihrer Hand. Bei einem Angriff auf Warendorf werden Sie jetzt entscheiden müssen. Bedenken Sie dabei aber, dass eine evtl. Besetzung der Stadt nur kurze Zeit dauern wird, denn vom Teutoburger Wald aus, wo erhebliche Truppenverbände bereit stehen, erfolgt der Rückschlag.“ Mit diesen Worten hatte Bürgermeister Hase die Verantwortung für die Stadt dem Stadtrendanten Theodor Lepper und dem Standortältesten Oberst Winkel übertragen. Alles war kopflos und führungslos. Viele Bürger verließen die Stadt und brachten sich auf Bauerhöfen in Sicherheit.
 |
| Oberst Winkel nach dem Krieg |
Theodor Lepper reagierte umsichtig und klug. Als erstes ließ er die am Münstertor bei der Gaststätte Höner angelegten Panzergräben beseitigen, denn damit wäre den anrückenden Truppen signalisiert worden, dass Warendorf verteidigungswillig ist. Um sich mit den alliierten Truppen verständigen zu können, bat er Oberstudienrat Blum, sich als Dolmetscher bereit zu halten. Auch Blum erkannte den Ernst der Lage und willigte sofort ein. In der Polizeistation im Rathaus wurde eine ständige Wache eingerichtet. Hier bezog auch Stadtrendant Lepper sein Standquartier.
Etwa gegen 17.30 Uhr hängte Kathrinchen Wonnemann am Haus Markt
12 eine weiße Fahne heraus und schnell wurden viele weiße Fahnen, also
weiße Betttücher, in der ganzen Stadt gehisst. Der Schreinermeister
Heinrich Webbeler kletterte in den Turm der Laurentiuskirche und hängte
die weiße Fahne aus, damit weit sichtbar war, dass Warendorf sich nicht
verteidigen will. Dieses Zeichen der Ergebung wurde von zwei alliierten
Aufklärungsfliegern, die gegen 18.30 Uhr über die Stadt flogen,
verstanden und die vier Bomber drehten wieder ab. Die Zerstörung
Warendorfs war abgewendet.
Die weißen Fahnen wollte der zuständige Offizier der Waffen-SS
jedoch nicht dulden. Die Warendorfer weigerten sich, sie einzuziehen.
Als aber der Hauptsturmführer drohte, die Häuser zu beschießen, wurden
die weißen Fahnen dann doch eingezogen.
Die SS wollte noch „jede Straße, jedes Haus, jede Treppenstufe“
verteidigen. Zwei Lastwagen mit SS-Truppen trafen in Warendorf ein und
besetzten jeden Stadteingang und jede Kreuzung. Der übereifrige
Hauptsturmführer, der die Befehle gegeben hatte, wurde noch in derselben
Nacht bei einer Erkundungsfahrt nach Hoetmar verwundet und gefangen
genommen. Sein Adjutant wurde durch Schüsse aus einem Panzerspähwagen
getötet.
Jetzt übernahm ein junger Leutnant, der nicht so fanatisch war,
die Führung der SS-Truppen in der Stadt. Ein Glück für Warendorf!
Der folgende Ostersonntag war ruhig, die meisten Warendorfer
hatten ihre wichtigste Habe auf Bollerwagen und Fahrräder gepackt und
waren in die Bauernschaften geflohen, um den Gefahren einer Beschießung
zu entgehen.
Am Ostermontag kam ein Pionierkommando nach Warendorf, das den
Auftrag hatte, die Emsbrücken zu sprengen. Alles wurde für die Sprengung
vorbereitet. Theodor Lepper versuchte, sie von dem Vorhaben abzubringen,
was ihm aber nicht gelang. Es wird erzählt, dass in der Zwischenzeit
zwei mutige Warendorfer unter den Brücken die Zündschnüre
durchgeschnitten hätten. Eine heroische Tat, denn die Brücken wurden
streng bewacht. Wie gefährlich eine solche Tat damals war belegt das
Schicksal des versprengten Pioniers Otto Hermann aus Gelsenkirchen. Er
hatte die vorgesehene Sprengung der Brücke als Blödsinn bezeichnet und
war deshalb von der SS kurzerhand erschossen worden. Die Leiche des
38jährigen Soldaten legte die SS zur Abschreckung an das Kriegerdenkmal.
Später wurde Otto Hermann auf dem Warendorfer Friedhof begraben.

Als der Führer des Sprengkommandos am Ostermontag gegen 11.30
Uhr das Signal zur Sprengung gab, fiel nur ein Teil der dreibogigen
Emsbrücke der Detonation zum Opfer. Die Brücke an der Gartenstraße und
die Teufelsbrücke kamen ohne Schaden davon. Die Sabotagemaßnahmen der
mutigen Warendorfer Bürger waren erfolgreich gewesen. Trotzdem erlitt
die städtische Wasserleitung und das Dachgeschoss des Hauses Wulff
schwere Schäden. Fast alle Fensterscheiben der umliegenden Häuser und in
der Firma Brinkhaus gingen zu Bruch.
Am Osterdienstag kam gegen 10.15 Uhr die Meldung, dass
amerikanische Truppen soeben in Warendorf eingerückt seien und an der
Ecke Münsterstraße/Freckenhorster Straße bei Pletzer stünden.
Stadtrendant Lepper ging eilig zum Kommandanten der amerikanischen
Truppe und brachte ihn zum inzwischen installierten Bürgermeister
Schmücker. Mit Hilfe von Oberstudienrat Blum als Dolmetscher gab der
Kommandeur der amerikanischen Truppe den Bürgern von Warendorf die
Anweisung, die Straßen sofort zu räumen. Ein Ausgang war nur von 9-12
Uhr zum Einkauf der nötigen Lebensmittel erlaubt. Der Verkauf von
Spirituosen wurde sofort verboten.
Mit Hilfe des Beigeordneten Schmücker als Bürgermeister, dem
Stadtrendanten Lepper und Oberst Winkel und dem engagierten Einsatz von
Oberstudienrat Blum gelang es, in diesen ersten kritischen Tagen Ruhe
und Ordnung zu bewahren und einen reibungslosen Umgang mit der
Besatzungsmacht zu erreichen. Ihrem Mut ist es zu verdanken, dass
Warendorf das Kriegsende so glimpflich überstanden hat. Dafür müssen wir
noch heute dankbar sein, denn ohne ihre Umsicht sähe unsere Stadt heute
anders aus.
Der Warendorfer Nachkriegsschriftsteller Paul Schallück hat in
„Weiße Fahnen im April“ mit dichterischer Freiheit aus den Ereignissen
dieser letzten Kriegstage eine sehr treffende Erzählung gemacht,
erschienen in „Kleine Westfälische Reihe“ Heft 3 aus dem Jahr 1955.
Quelle:
mündliche Überlieferung
Theo Lepper: Die letzten Tage des 2. Weltkrieges in Warendorf
in: Warendorfer Schriften 6/7 1977 S. 155-159
Paul Schallück hat in „Weiße Fahnen im April“ mit
dichterischer Freiheit aus den Ereignissen diese letzten Kriegstage eine
sehr treffende Erzählung gemacht.
Kleine Westfälische Reihe Heft 3 1955
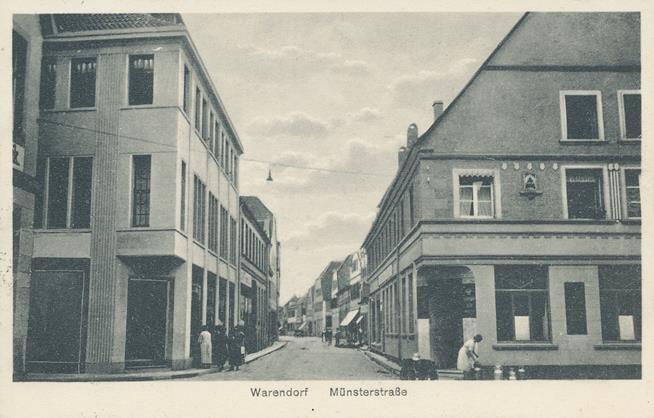
Kreuzung Münsterstraße: hier traf der Stadtrendant Lepper auf die Amerikanischen
Truppen
Erlebte Geschichte in Warendorf:
Eugenie Haunhorst-Göcke erinnert sich an ihre Jugend in
Warendorf
Schlittschuhlaufen auf der Ems
von Eugenie Haunhorst
von Eugenie Haunhorst
 In
den Jahren 1925 bis 1930 bescherte uns der anhaltende Frost sehr
kalte Winter. 1927 und 1928 war sogar die Ems zugefroren und
trug über Wochen eine dicke, solide Eisdecke – ideal für uns zum
Schlittschuh laufen.
In
den Jahren 1925 bis 1930 bescherte uns der anhaltende Frost sehr
kalte Winter. 1927 und 1928 war sogar die Ems zugefroren und
trug über Wochen eine dicke, solide Eisdecke – ideal für uns zum
Schlittschuh laufen.
Ungeduldig erwarteten wir auf das Ende des Unterrichts.
Mutter wusste, dass wir schnell aufs Eis wollten und das
Mittagessen stand bei unserer Ankunft zu Hause dampfend auf dem
Tisch. Nach der Stärkung zogen wir unter unseren Faltenrock
dicke, wollene Strümpfe an, dazu zwei bis drei Strickpullover,
einen dicken Schal, eine warme Mütze und handgestrickte
Fausthandschuhe. Lange Hosen und dicke Jacken waren für uns
Mädchen noch nicht erfunden. Heute wundere ich mich, dass wir
bei der klirrenden Kälte nicht gefroren haben.

Die flotten Schlittschuhläuferinnen mit bunten Pullovern und
langen Zöpfen, Eugenie oben links
An einem Lederriemen trugen wir die beiden klimpernden
Schlittschuhe durch die sonnige Winterluft zur Ems. Wir setzten
uns auf das alte Waschbrett bei Wulf und schnallten unsere
Schlittschuhe unter unsere normalen Straßenschuhe. Einen extra
Schuh mit festgemachtem Schlittschuh kannte man noch nicht. Wie
gut, dass Mutter uns zu Anfang des Winters feste, hohe Schuhe
gekauft hatte, die waren ideal zum Schlittschuh laufen. Mit dem
Schlittschuhschlüssel wurde der eiserne Schlittschuh mit den
Krampen am Absatz und vorne an der breitesten Stelle des Schuhes
fest angeschraubt. Mit zwei Lederriemen um den Knöchel und um
den Fuß wurde die Sicherheit erhöht. Beim Anschnallen beeilten
wir uns immer sehr, denn sonst wurde es uns zu kalt auf dem
eisigen Brett. Hier an der Emsbrücke starteten alle
Schlittschuhläufer, die in Richtung Osten fahren wollten. Auf
der westlichen Seite der Brücke lagen das Wehr und das
städtische Elektrizitätswerk. Das herunterfallende Wasser wurde
zur Stromerzeugung gebraucht. Am Wehr war natürlich kein festes
Eis.

Die großbürgerlichen Töchter mit Mantel und die Gymnasiasten mit
Schülermütze
Mit einem tiefen Schritt gelangten wir auf die feste
Eisdecke unserer Ems. Wir zogen die ersten Versuchskurven, dann
ging es los gen Osten. Die zugefrorene Ems hatte nicht überall
eine glatte Eisfläche, wir mussten gut aufpassen. Wir fuhren
vorbei an Cordes, Lohmanns und an der Quabbe mit dem Bentheimer
Turm. An der Stelle, wo sich im Sommer die Badeanstalt befand,
war eine große Freifläche entstanden. Hier trafen wir uns mit
unseren Freunden und Freundinnen, denn der Platz war ideal zum
Laufen von größeren Kurven, zum Paarlaufen und Figuren üben. In
den Verschnaufpausen wurde getratscht und viel gelacht und genau
beobachtet, wo sich neue Freundschaften anbahnten. An dieser
Stelle traf sich auch die Gruppe der Unermüdlichen, die die Ems
aufwärts in Richtung Vohren laufen wollte, vorbei an der
Herrlichkeit bis zu Bauer Sechelmann. Eine herrliche Strecke
durch die oft verschneite Emslandschaft. Viel zu schnell wurde
es dunkel und manchmal konnten wir bei dem Wettlauf mit der
Dämmerung ein wunderschönes Abendrot genießen.

Lustige Verschnaufpause
In nicht so kalten Wintern boten sich der Emskamp,
die Glockenkuhle und der dritte Emsarm mit ihrer festen Eisdecke
an. Ideal war die Krankenwiese, heute Lohwall genannt. Vor der
Begradigung der Ems war diese große Fläche oft lange Zeit
überflutet. Wenn die Wasserfläche ohne Wind, also auch ohne
Windeis, glatt zugefroren war, entstand hier eine ideale
Eislauffläche. Da unter dem Eis nur etwa 20 cm Wasser auf den
Wiesen stand, war die Fläche schnell zugefroren. Ein Einbrechen
in tiefes, kaltes Wasser und eventuelles Ertrinken stellte hier
keine Gefahr dar.
In der Verwaltungsspitze im Rathaus gab es auch Freunde
des Eislaufens. Nur leider endete die Dienstzeit erst, wenn es
schon dunkel war. Der Bürgermeister hatte eine gute Idee und
gute Ideen müssen schnell umgesetzt werden. Auf seine Order hin
wurden am Weg an der Ems entlang und auf der Eisfläche der
Krankenwiese einige Scheinwerfer aufgestellt. Die angestrahlte
Eisfläche mit dem Panorama der Stadt im Hintergrund war
zauberhaft, schöner ging es nicht. Nicht nur Jugendliche, auch
viele Warendorfer Bürger sah man nun allabendlich mit großer
Begeisterung im Scheinwerferlicht Schlittschuh laufen.
Wer sich nicht auf das glatte Eis traute, genoss die
wunderschöne Atmosphäre bei einem Abendbummel.

Die Autorin Eugenie Haunhorst geb. Göcke
wurde 1912 in Warendorf geboren und wuchs in
einer Lehrerfamilie mit vier Geschwistern auf.
Im Alter von 90 Jahren begann sie, Erinnerungen
aus ihrem Leben im Warendorf der 1920er Jahre
aufzuschreiben. Sie starb 2016 im Alter von 103
Jahren.
Interessantes und Aktuelles vom Heimatverein Warendorf
Hier zum Herunterladen:
Der neue KIEPENKERL 2025
Turbulente 15 Jahre im Heimatverein: Rückblick der Vorsitzenden Mechtild Wolff
Vor 80 Jahren: Die letzten Tage des 2.
Weltkriegs in Warendorf Ostern 1945
Das Portrait: Dr. h.c. Heinrich Windelen
Aus Anlass des Denkmaltages am 8. 9. 2024:
Motto: "Wahrzeichen - Zeitzeugen der Geschichte"
Der Warendorfer Bürger-Schützenhof – eine
Erfolgsgeschichte mit traurigem Ende
Der erste große Stadtbrand von Warendorf aus dem Jahre 1404
Das Portrait: Joos Brandkamp, Kirchen- und Kunstmaler
(1905 - 1983)
von Mechtild Wolf
100 Jahre Frauenwahlrecht - Erinnerungen an Clara
Schmidt in Warendorf und die Frauenbewegung
Clara Schmidt und die Frauenliste
Fakten und Historie
Westfälisch Platt:
von Franz Schulte Nahrup
Heimatfest Mariä Himmelfahrt
Erlebte Geschichte: Mariä Himmelfahrt in den 1920er
Jahren von Eugenie Haunhorst
Unser engagiertes Ehrenmitglied Kurt Heinermann verstarb
im Alter von 91 Jahren
Anni Cohen und ihre Familie - von Warendorf nach Südafrika und Palästina
von Mechtild Wolff
Eduard Elsberg erbaute das erste große Kaufhaus in Warendorf
von Mechtild Wolff
Der
Elsbergplatz
von Dr. Bernward Fahlbusch
Das Fahrrad, ein wertvoller Besitz
von Eugenie Hauenhorst
Aus der Warendorfer Eisenbahngeschichte:
Der "Neue Bahnhof" in Warendorf von Mechtild Wolff
Aus der Warendorfer Eisenbahngeschichte:
Der "Alte Bahnhof" in Warendorf
Der Warendorfer Friedhof - Spiegel der Stadtgeschichte
Gebr. Hagedorn und Co, eine Landmaschinenfabrik mit Eisengießerei
Das Dezentrale
Stadtmuseum
ist in der Regel an Sonntagen von 15:00 - 17:00 Uhr geöffnet. Dazu
gehören das Rathaus, das Bürgerhaus Klosterstraße 7 mit den
handgedruckten Bildtapeten und das Gadem am Zuckertimpen 4
Der Eintritt ist frei.


Unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende:
Heimatverein Warendorf e.V.
Düsternstraße 11
48231 Warendorf
IBAN DE89400501500000063156
Sparkasse Münsterland Ost
Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03
E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de
Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden
