Das Portrait:
Josef Heinermann (1895 - 1956)
Bäckermeister und Bürgermeister
von Mechtild Wolff
von Mechtild Wolff

Bürgermeister Josef Heinermann (1951)
Der wichtigste Bürgermeister der Nachkriegsjahre war Josef
Heinermann. Damals war das Bürgermeisteramt noch ein politisches
Ehrenamt. In seiner Amtszeit erlebte er vier Stadtdirektoren: Dr. Alfred
Schmitz (1947-49), Dr. Paul Eising (1949-51), Dr. Karl Schnettler
(1952-55) und Dr. Kurt Mertens (1955-67).

1956 Neujahrsempfang Stadtdirektor Dr. Mertens und Bürgermeister
Heinermann mit dem Stadtverordneten Paul Wemhoff und Oberst a.D. Winkel
Diese Stadtdirektoren waren durchsetzungsfähige, stringente
Verwaltungs-chefs; da war es gut, dass Bürgermeister Heinermann durch
sein verständnisvolles, freundliches Wesen manche Wogen glätten konnte.
Im Hauptberuf war Josef Heinermann Bäckermeister. Am 15.
Oktober 1895 wurde er als fünftes von zehn Kindern in seinem Elternhaus
an der Kirchstraße 3 geboren. Hier führten seine Eltern Bernhard und
Theresia Heinermann eine der besten Bäckereien Warendorfs. Wie einige
seiner Geschwister wollte auch Josef Heinermann gern das Gymnasium
Laurentianum besuchen, aber sein Vater hatte ihn für die Nachfolge in
der Bäckerei vorgesehen. Darum begann er mit 13 Jahren seine
Bäckerlehre, machte seinen Meister und übernahm 1924 nach dem Tode
seines Vaters die Bäckerei. Ihm hat dieser Beruf Zeit seines Lebens viel
Freude gemacht und noch heute erinnert man sich in Warendorf an die
köstlichen Heinermannschen Spekulatius, die er nach einem alten
Familienrezept zur Weihnachtszeit in großen Mengen herstellte. Seine
ganz besondere Liebe galt den Festtagstorten, die er mit viel Phantasie
garnierte.
Josef Heinermann hat in beiden Weltkriegen gedient und sie Gott
Dank unversehrt überstanden. Dafür war er stets dankbar und tat alles,
um den Frieden zu erhalten.


Familie Heinermann 1939
1956 Neujahrsempfang Stadtdirektor Dr. Mertens und Bürgermeister
Heinermann mit dem Stadtverordneten Paul Wemhoff und Oberst a.D.
Winkel
1928 heiratete er Ludowika, die Tochter des Gastwirts Bernhard
Niemer. Durch seine Liebe zur Musik hatte er sie kennengelernt, denn der
Männergesangverein Lyra hielt seine wöchentlichen Proben im Saal der
Gastwirtschaft Niemer am Osttor ab. Aus der Ehe gingen 11 Kinder hervor,
von denen zwei im Kindesalter verstarben.
Neben seiner Sorge für die große Familie und den Bäcker- und
Konditorbetrieb engagierte sich Josef Heinermann in vielfältiger Weise
in seiner Heimatstadt. Natürlich war er Mitglied im Schützenverein, war
Kolpingbruder und sang im Kirchenchor und in der Lyra. Lange Jahre war
er Mitglied des Kirchenvorstandes St. Laurentius und gehörte dem
Kuratorium des Josephs-Hospitals an. Außerdem engagierte er sich als
stellv. Innungsobermeister der Bäckerinnung und im Vorstand der
Kreishandwerkerschaft.
Schon Anfang der 1930 Jahre schloss er sich der kath.
Zentrumspartei an und wurde im März 1933 zum Stadtverordneten gewählt.
Das war aber nur von kurzer Dauer, denn schon im Juli 1933 verließ er
den Stadtrat, weil er nicht zur NSDAP übertreten wollte.
Als 1945 der Zweite Weltkrieg und damit der braune Spuk beendet
war, gehörte Josef Heinermann zu den Gründern der CDU in Warendorf und
wurde deren zweiter Vorsitzender. 1946 ernannte ihn die Militärregierung
zum Stadtverordneten und bei den ersten demokratischen Wahlen nach dem
NS Regime wurde er in den Stadtrat gewählt.

Wohnraum für Flüchtlinge
Es mussten aber viele große Probleme gelöst werden. Am
drängendsten war das Flüchtlingsproblem. Schon in der 1. Ratssitzung
mahnte der Vertreter der britischen Besatzungsmacht, Kreisresident Mr.
Pit, dass er die menschenunwürdige Unterbringung der Heimatvertriebenen
nicht mehr dulden werde. Die Stadt müsse Möglichkeiten der
Wohnraumbeschaffung finden.

1948 wurde der Verein „Christliche Siedlungshilfe Warendorf“ gegründet und
am 27. März 1949 konnte der Grundstein für eine neue Siedlung an der
Ludgeristraße gelegt werden.
 Der
Grundstein stammte aus den Trümmern des Domes zu Münster. Hier wurde mit
Unterstützung der Kirche und der Stadt die Idee des
Selbsthilfe-Siedlungsbaus verwirklicht, bei der jeder Siedler mindestens
2000 Arbeitsstunden einbringen musste. Über 90 000 Schlackensteine
wurden in Handarbeit vor Ort gefertigt und schon 1950 konnten die ersten
Häuser der Ludgeri-Siedlung bezogen werden. Beim Einzug in ihr Haus
wurde den Siedlern ein Schwein, ein Bollerwagen, ein Kesselofen, ein
Jauchefass, eine Schaufel, eine Mistforke und Bäume und Sträucher für
den Garten übergeben. „Helft Wohnungen bauen“, war das Motto vieler
Straßensammlungen in Warendorf. Bald entstanden auch an der
Sternbergstraße, an der Strumannstraße, der Johanna-Küster-Straße, am
Grünen Grund und am Walgernweg weitere Siedlungen.
Der
Grundstein stammte aus den Trümmern des Domes zu Münster. Hier wurde mit
Unterstützung der Kirche und der Stadt die Idee des
Selbsthilfe-Siedlungsbaus verwirklicht, bei der jeder Siedler mindestens
2000 Arbeitsstunden einbringen musste. Über 90 000 Schlackensteine
wurden in Handarbeit vor Ort gefertigt und schon 1950 konnten die ersten
Häuser der Ludgeri-Siedlung bezogen werden. Beim Einzug in ihr Haus
wurde den Siedlern ein Schwein, ein Bollerwagen, ein Kesselofen, ein
Jauchefass, eine Schaufel, eine Mistforke und Bäume und Sträucher für
den Garten übergeben. „Helft Wohnungen bauen“, war das Motto vieler
Straßensammlungen in Warendorf. Bald entstanden auch an der
Sternbergstraße, an der Strumannstraße, der Johanna-Küster-Straße, am
Grünen Grund und am Walgernweg weitere Siedlungen.
Die neuen Emsbrücken
Schon zu Mariä Himmelfahrt 1949 wurde die neue Brücke an der
Gartenstraße fertiggestellt. Der Neubau dieser Umgehungsbrücke war
notwendig geworden, weil die alte Linnenbrücke nicht tragfähig genug
war, um für die Zeit des Baus der großen Emsbrücke den gesamten
Umleitungsverkehr aufnehmen zu können.
 Am
2. April 1950 konnte dann auch die große Emsbrücke eingeweiht werden,
die unter der Bauleitung von Stadtbauoberinspektor Isselstein in einer
Rekordbauzeit von nur fünf Monaten aus Ibbenbürener Sandstein errichtet
worden war. In seiner Festansprache erinnerte Bürgermeister Heinermann
daran, dass vor genau fünf Jahren in den letzten Kriegstagen 1945 die
alte Emsbrücke von der SS trotz der Proteste der Stadtverwaltung und der
Bürger gesprengt worden war. Die in aller Eile errichtete Behelfsbrücke
hatte gute Dienste geleistet, hatte die vielen Flüchtlinge gesehen, die
vom Bahnhof zum Landgestüt geleitet worden waren, wo sie behelfsmäßig
ihre Erstversorgung fanden, hatte aber auch die marodierenden Russen und
Polen gesehen, die die Stadt- und Landbevölkerung in Angst und Schrecken
versetzten. Die neue Brücke setzte ein hoffnungsvolles Zeichen für den
politischen und wirtschaftlichen Aufbau. In einen Sandstein der Brücke
wurde der Spruch von Anton Aulke eingemeißelt: „Nao Kriegsnaut met
Guotts Hölp wier upbaut.“
Am
2. April 1950 konnte dann auch die große Emsbrücke eingeweiht werden,
die unter der Bauleitung von Stadtbauoberinspektor Isselstein in einer
Rekordbauzeit von nur fünf Monaten aus Ibbenbürener Sandstein errichtet
worden war. In seiner Festansprache erinnerte Bürgermeister Heinermann
daran, dass vor genau fünf Jahren in den letzten Kriegstagen 1945 die
alte Emsbrücke von der SS trotz der Proteste der Stadtverwaltung und der
Bürger gesprengt worden war. Die in aller Eile errichtete Behelfsbrücke
hatte gute Dienste geleistet, hatte die vielen Flüchtlinge gesehen, die
vom Bahnhof zum Landgestüt geleitet worden waren, wo sie behelfsmäßig
ihre Erstversorgung fanden, hatte aber auch die marodierenden Russen und
Polen gesehen, die die Stadt- und Landbevölkerung in Angst und Schrecken
versetzten. Die neue Brücke setzte ein hoffnungsvolles Zeichen für den
politischen und wirtschaftlichen Aufbau. In einen Sandstein der Brücke
wurde der Spruch von Anton Aulke eingemeißelt: „Nao Kriegsnaut met
Guotts Hölp wier upbaut.“
Auch bei der Brückeneröffnung sammelte die Freiwillige
Feuerwehr mit dem Slogan: „Dein Brückengeld für den Wohnungsbau“.
Der Bau der neuen Volksschule im Norden der Stadt
Am 9. Juli 1950 wurde der Grundstein für die neue Volksschule
im Norden der Stadt gelegt. Sie sollte später den Namen Josefschule
bekommen. Bürgermeister Heinermann verlas den Text der Urkunde, die
danach eingemauert wurde.
 |
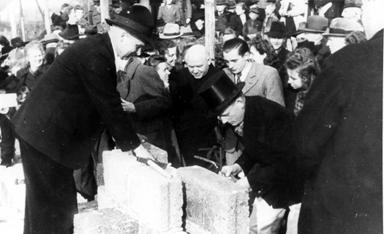 |
| Richtfest der Josefschule | Grundsteinlegung der Josefschule im Norden der Stadt |
Der Schulausschuss-Vorsitzende Oberstudienrat Heinrich Blum zeigte
sich in seiner Rede erleichtert, dass die Stadt dieses große Bauprojekt
wagte, denn die Warendorfer Schulen platzten wegen der vielen Schüler,
die als Flüchtlinge nach Warendorf gekommen waren, aus allen bau an der
Kapellenstraße. Pfarrer Hast und Pastor Radü baten um den Seg Nähten.
Auch Landrat Dr. Karl Esser war hocherfreut über den Schulneuen Gottes
für die neue Volksschule. Alles lief nach Plan und schon bald konnte der
Richtkranz aufgehängt werden.
Die 750-Jahr-Feier der Stadt Warendorf
„Nun ist endlich der Tag gekommen, dem seit Wochen und Monaten unser Denken und Planen und unsere Vorfreude gegolten hat. Die Festwoche aus Anlass der 750. Wiederkehr der Stadtwerdung Warendorfs hat begonnen. Mit großer Freude wollen wir den Geburtstag unserer lieben Heimatstadt feiern.“



So gab Bürgermeister Heinermann seiner Freude Ausdruck, als er am 28. April 1951 das Stadtjubiläum mit einer Festsitzung des Rates im historischen Rathaus eröffnete. Die Handwerksmeister August Rüschenbeck, Josef Dreischulte und Max Goebeler überreichten aus Anlass dieses denkwürdigen Tages dem Bürgermeister eine neue Amtskette, die von den Warendorfer Handwerkern gestiftet wurde. Am nächsten Tag, einem Sonntag, fand nach einem Festgottesdienst in den Kirchen und einem Empfang der Ehrengäste im Rathaus der Festakt der Stadt im vor einem Jahr erbauten Theater am Wall statt. Am Abend krönt die Aufführung der Oper „Julius Cäsar“ von G.F. Händel den Festtag.


Und die Post brachte einen Sonderstempel heraus. Ein besonderer
Höhepunkt war der Festumzug, an dem jeder teilnehmen konnte. Ein ganz
besonderer Spaß für die vielen Kinder.
Bis zum 6. Mai gab es einen bunten Strauß sportlicher und
kultureller Veranstaltungen. Auf dem Lohwall begeisterte die große
„Gewerbeschau für Stadt und Land“ die Bürger und zahllose Besucher von
nah und fern. Bürgermeister Heinermann hielt in der Festwoche nicht
weniger als 28 Reden.
Patenschaft mit der schlesischen Stadt Reichenbach
(Eulengebirge)

Anlässlichder 750-Jahr-Feier übernahm die Stadt Warendorf die Patenschaft über die schlesische Stadt Reichenbach. Damit gehörte Warendorf nach Goslar und Köln zu den ersten deutschen Städten, die eine solche Patenschaft abschlossen, um den aus ihrer angestammten Heimat Geflüchteten und Vertriebenen eine ideelle und oft eine reale neue Heimat zu bieten. Bürgermeister Heinermann übergab dem ehemaligen Reichenbacher Bürgermeister Schönwälder die Patenschafts-Urkunde und bekam von ihm die Reichenbacher Stadtfahne überreicht.


Hoher Besuch in Warendorf
Haile Selassi stattete 1954 dem wieder entstehenden Deutschland einen
offiziellen Staatsbesuch ab. Das war ein ganz großes Ereignis, denn er
war das erste ausländische Staatoberhaupt, das der jungen Bundesrepublik
diese Beachtung erwies. Und dieser Staatsgast kam am 12. November 1954
auch in das kleine Landstädtchen Warendorf - welch eine Ehre.

Nach dem herzlichen Empfang durch Bürgermeister Heinermann am
festlich herausgeputzten Bahnhof fuhren die prominenten Gäste im
Schritttempo durch die mit Fahnen und Wimpelketten geschmückte Stadt,
angeführt von 30 Standartenreitern. Kaiser Haile Selassi winkte aus
einem offenen Mercedes 300 Kabriolett der jubelnden, Fähnchen
schwingenden Menge zu.




Bürgermeister Josef Heinermann und Stadtdirektor Dr. Karl Schnettler,
Landrat Dr. Josef Höchst, der Regierungspräsident Franz Hackethal, der
Landesminister Dr. Johannes Peters und Bundesernährungsminister Heinrich
Lübke vertraten Stadt und Land sehr würdig. Landstallmeister Bresges
erläuterte dem begeisterten Kaiser und seinem Gefolge die kleine
Hengstparade und die olympische Lektion, die der Primaner Rainer Klimke
elegant präsentierte.
In der Deula wurden hochmoderne Landmaschinen vorgeführt, von
Kleingeräten für den Garten bis zu den großen Mähdreschern der Firma
Claas. Reich beschenkt mit deutschen Industrieerzeugnissen, wie z.B.
einer Buttermaschine der Firma Westfalia Separator aus Oelde verließ der
Kaiser in seinem kaiserlichen Sonderzug pünktlich um 16.39 Uhr den
Bahnhof von Warendorf in Richtung Hamburg.


Weltmeister Hans Günter Winkler
Hans Günter Winkler wurde 1954 und 1955 Weltmeister und gewann mit
dem mittlerweile legendären Ritt 1956 seine erste olympische
Goldmedaille. Bei seiner Rückkehr nach Warendorf wurde Winkler schon an
den Stadttoren von Bürgermeister Heinermann und Stadtdirektor Dr.
Schnettler mit einer großen Reiterstaffel begrüßt und in einer Kutsche
zum offiziellen Empfang der Stadt ins Rathaus gefahren. An den
Straßenrändern und auf dem Marktplatz feierten ihn die begeisterten
Warendorfer.



Mitten aus dem Leben gerissen
Im Mai 1956 trug Josef Heinermann folgende Termine in seinen
Kalender ein:
Sonntag, 27. Mai: Treffen Reichenbach
Montag, 28. Mai: Ratssitzung
Dienstag, 29. Mai: Westfälisch Lippischer Heimattag
Am Dienstag hielt er auf dem Westfälisch Lippischen Heimattag
im Bürgerschützenhof seine letzte Rede. Da er sich nicht wohl fühlte,
ging er an der Ems entlang zu Fuß nach Hause. Am Abend starb er
plötzlich und unerwartet an seinem Schreibtisch an einem Herzschlag.
In einem Nachruf hieß es:
„Ganz Warendorf trauert um den ersten und besten Bürger der
Stadt. Völlig unerwartet erlag Bürgermeister Heinermann, im 61.
Lebensjahr stehend, am Dienstagabend einem Herzschlag, nachdem er noch
am Vormittag den Heimattag besucht hatte. Bürgermeister Heinermann war
zweifelsohne die markanteste Persönlichkeit im öffentlichen Leben der
Stadt Warendorf, ein Mann des gerechten Ausgleichs, der in allen Kreisen
der Bevölkerung ob seiner lauteren Haltung, seiner Gewissenhaftigkeit,
seines unermüdlichen Einsatzes für die Allgemeinheit, seiner Güte und
seines steten Bemühens, jedem Menschen helfen zu wollen, Hochachtung und
Verehrung genoss.“
Ja, ganz Warendorf trauerte um seinen beliebten Bürgermeister
Josef Heinermann und gab ihm das Geleit, als er hier auf dem Friedhof
begraben wurde. Am Weg von der Kirche zum Friedhof bildeten die Schüler
und Schülerinnen der Warendorfer Schulen ein Spalier.
Erst jetzt wurde den Warendorfer Bürgern bewusst, welch ein
enormes Arbeitspensum Bürgermeister Josef Heinermann während seiner fast
acht Amtsjahre bewältigt hatte. Neben den repräsentativen und
politischen Aufgaben als Bürgermeister fielen bedeutende
stadtgeschichtliche Ereignisse in seine Amtszeit:
Die wichtigsten Ereignisse waren:
- die menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge
- die Einweihung der Kriegergedächtnis-Kapelle im Turm der
alten Marienkirche
- das Deutsche Olympische Komitee für Reiterei bekommt seinen
Sitz in Warendorf
- der Bau von zwei neuen Emsbrücken, die Linnenbrücke und die
Marktbrücke
- die 750-Jahr-Feier der Stadt Warendorf
- die Übernahme der Patenschaft über die schlesische Stadt
Reichenbach
- die Modernisierung des städtischen Schlachthofes
- die Einrichtung der Landwirtschaftsschule
- der Neubau der Josefschule im Norden der Stadt
- Besuch des äthiopischen Kaisers Haile Selassi
- Einweihung des neuen Volksbank-Gebäudes am
Wilhelmsplatz
- Einweihung des neuen Flügels des Josephs-Hospitals

Haus Heinermann an der Kirchstraße
Nr. 3
Aquarell von Elli Grützner




1955 Fettmarkt-Ausstellung „Schaffen und Streben“
Hermann Merkentrup: Die Christliche Siedlungshilfe Warendorf im Warendorfer Kiepenkerl Nr. 66 Juni 2015
Berichte aus der Familie Heinermann und von Zeitzeugen
Bilder: Kurt Heinermann und Hermann Merkentrup
Persönlichkeiten
Heinrich Blum, von allen "Mister Blum" genannt
Franz Joseph
Zumloh, der Begründer des Josephshospitals
Maria Anna
Katzenberger und Heinrich Ostermann
Hermann Josef
Brinkhaus,
Gründer der Firma Brinkhaus
Eduard
Wiemann und die Villa Sophia
Anna
Franziska Lüninghaus, Gründerin der Marienstiftung
Wilhelm
Zuhorn, Geheimer Justizrat und Geschichtsforscher
Bernard
Overberg, der Lehrer der Lehrer
Arthur
Rosenstengel, Seminarlehrer, Musikerzieher und Komponist
Pauline
Hentze, Begründerin der Höheren Töchterschule
Franz
Strumann, Pastor und Förderer der höheren Mädchenbildung
Dr. Maria
Moormann, die mutige Direktorin der Marienschule
Josef Pelster,
der Schulrat und Naturfreund
Wilhelm
Diederich, Bürgermeister von 1869-1904
Hugo
Ewringmann, Bürgermeister von 1904-1924
Theodor
Lepper, Stadtrendant und Retter in den letzten Kriegstagen
Clara Schmidt,
Kämpferin für die Frauenliste im Stadtparlament
Elisabeth
Schwerbrock, eine hochengagierte Stadtverordnete,
Eugenie
Haunhorst, die Kämpferin für ihre Heimatstadt
Paul Spiegel,
Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland
Paul
Schallück, der vergessene Nachkriegsschriftsteller
Heinrich
Friedrichs, ein Warendorfer Künstler
Theo
Sparenberg, Kinokönig und Tanz- und Anstandslehrer
Wilhelm
Veltman, Retter der historischen Altstadt
Rainer. A. Krewerth, ein schreibender Heimatfreund
Prof. Dr. Alfons
Egen
ein begnadeter Lehrer und Heimatfreund
Änneken Kuntze und ihre Schwester Lilli
Elisabeth Schwerbrock, Stadtverordnete in Warendorf
Anni Cohen und ihre Familie - von Warendorf nach Südafrika und Palästina
Eduard Elsberg erbaute das erste große Kaufhaus in Warendorf
Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03
E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de
Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden
