Erlebte Geschichte in Warendorf von Eugenie
Haunhorst
Fettmarkt in den Zwanziger Jahren
 Fettmarkt,
das war ein Höhepunkt in unserem Kinderleben.
Ich bin am Münsterwall aufgewachsen und erlebte
den Trubel aus nächster Nähe. Auf dem
Wilhelmsplatz fanden der Viehmarkt und die
Kirmes statt, die
Fettmarkt,
das war ein Höhepunkt in unserem Kinderleben.
Ich bin am Münsterwall aufgewachsen und erlebte
den Trubel aus nächster Nähe. Auf dem
Wilhelmsplatz fanden der Viehmarkt und die
Kirmes statt, die
 Münsterstraße war auf beiden Seiten mit den
Ständen der Händler belegt und auf dem
Marktplatz boten die Bauern Kartoffeln, Kappes
und vieles mehr an. Direkt vor unserem Haus
baute der Lebkuchenbäcker Dammann aus
Harsewinkel seine große Bude auf. Er bekam von
uns Strom für die Beleuchtung des Standes. Dafür
gab es für uns Kinder am Abend eine große Tüte
Pfeffernüsse, die Spezialität des Hauses.
Münsterstraße war auf beiden Seiten mit den
Ständen der Händler belegt und auf dem
Marktplatz boten die Bauern Kartoffeln, Kappes
und vieles mehr an. Direkt vor unserem Haus
baute der Lebkuchenbäcker Dammann aus
Harsewinkel seine große Bude auf. Er bekam von
uns Strom für die Beleuchtung des Standes. Dafür
gab es für uns Kinder am Abend eine große Tüte
Pfeffernüsse, die Spezialität des Hauses.
 Ich
erinnere mich noch heute an den köstlichen
heißen Berliner, den Frau Werner meiner
Schwester Maria und mir einmal schenkte. Sie
hatte vor ihrem Haus an der Münsterstraße einen
Stand aufgebaut und verkaufte Berliner für ihren
Sohn, der eine Bäckerei in der Brünebrede hatte.
Manchmal verkaufte der Sohn auch selber.Der
Böttcher und Küfer Berger von der Molkenstraße
bot seine Holzerzeugnisse an: Holzfässer für
Sauerkraut, Butterfässer, Waschfässer und Wannen
jeder Größe und alle Holzgeräte für Haus und
Hof. Daneben stand in jedem Jahr der Wagenbauer
Schwarte von der Brünebrede. Hier suchte man
sich die neue Kutsche, den zweirädrigen Gig oder
den neuen Bollerwagen aus.
Ich
erinnere mich noch heute an den köstlichen
heißen Berliner, den Frau Werner meiner
Schwester Maria und mir einmal schenkte. Sie
hatte vor ihrem Haus an der Münsterstraße einen
Stand aufgebaut und verkaufte Berliner für ihren
Sohn, der eine Bäckerei in der Brünebrede hatte.
Manchmal verkaufte der Sohn auch selber.Der
Böttcher und Küfer Berger von der Molkenstraße
bot seine Holzerzeugnisse an: Holzfässer für
Sauerkraut, Butterfässer, Waschfässer und Wannen
jeder Größe und alle Holzgeräte für Haus und
Hof. Daneben stand in jedem Jahr der Wagenbauer
Schwarte von der Brünebrede. Hier suchte man
sich die neue Kutsche, den zweirädrigen Gig oder
den neuen Bollerwagen aus.
Das alles registrierten wir nur im Vorbeigehen.
Unser wichtigstes Ziel war die Kirmes. Von
unseren Eltern hatten wir 50 Pfennig Kirmesgeld
bekommen und unser Besuch bei Onkel Bernhard
hatte uns noch einmal 50 Pfennig eingebracht.
Eine ganze Mark – jetzt träumten wir von 10 mal
Kettenkarussell fahren. Zuerst kamen wir an dem
herrlich bunt bemalten Kinderkarussell vorbei,
die kleinen Sitzbänkchen waren mit vielen
Spiegeln zauberhaft verziert. Auf den
Holzpferdchen ritten stolz die Kleinen ihre
Runden. Opa fuhr zur Sicherheit mit und stützte
den Rücken.
Schwerarbeit musste das Pferd leisten, das
 den ganzen Tag um die Mittelachse des
Kinderkarussells trottete und es so zum Drehen
brachte. Nur beim Ein- und Aussteigen der
kleinen Gäste hatte das Tier eine kurze
Verschnaufpause. Erst Ende der Zwanziger Jahre
gab es elektrischen Antrieb für die Karussells.
den ganzen Tag um die Mittelachse des
Kinderkarussells trottete und es so zum Drehen
brachte. Nur beim Ein- und Aussteigen der
kleinen Gäste hatte das Tier eine kurze
Verschnaufpause. Erst Ende der Zwanziger Jahre
gab es elektrischen Antrieb für die Karussells.
Unser erstes Ziel war die „Kaffeemühle“. In
einer Trommel, etwa einen halben Meter hoch,
saßen zwei Kinder auf dem Rand und drehten im
Uhrzeigersinn das kleine Rad in der Mitte. Die
Trommel drehte sich in Gegenrichtung. Mit dem
Rad konnte man das Tempo bestimmen. Je
schneller, um so schöner! Später gab es den
„Teller“ auch die „Scheibe“ genannt. Das war ein
besonderes Gaudi und für junge Leute eine Art
Sport. In einem großen Zelt stand eine drehbare
Scheibe mit einem Durchmesser von 7-8 Metern.
Die Mitte war etwas erhöht. Rund um die Scheibe
herum war ein gepolsterter, ca. 50 cm hoher Rand
angebracht. Beim Startpfiff kletterten die
Jugendlichen über diesen Rand und suchten sich
einen Platz möglichst weit in der Mitte. Unter
lauter Musikbegleitung begann sich die Scheibe
zu drehen. Erst langsam, dann immer schneller.
Die außen Sitzenden wurden schnell an den Rand
geschleudert. Das Gejuchze wurde immer lauter,
die Platte drehte sich schneller und leerte sich
schneller. Erst wenn der Letzte aufgeben musste,
war das Spiel zu Ende und der Sieger wurde
lautstark gefeiert. Eine spannende Attraktion!
Dann gingen wir zur Schiffschaukel ! Am
schnellsten brachte man die Schaukel zu Zweit in
Schwung. Wir schaukelten so lange, bis sie fast
waagerecht stand. Unsere Mutter sagte uns immer,
das sei ein Sport für Jungen! Ich glaube, sie
wollte nicht gern, dass unsere Röcke so flogen.
Hosen gab es damals für Mädchen noch gar nicht.
Und dann der Höhepunkt: Das Kettenkarussell! Wie
herrlich war es, fest in dem Kettensitz sitzend,
durch die Luft zu fliegen. Wir überblickten den
Kirmesplatz, konnten unser Haus und die
Marienkirche sehen - uns lag ganz Warendorf zu
Füßen. Darauf hatten wir uns so lange gefreut
und zahlten gern noch einmal 10 Pfennig für
dieses Vergnügen.
 Eine unserer Freundinnen sagte einmal: „Ach wäre
ich doch ein Kettenkarussellkind, dann könnte
ich immerzu mit dem Kettenkarussell durch die
Luft fliegen.“ In der Schule hielt sie dann
Ausschau nach den „Kirmeskindern“, die während
ihres Aufenthaltes in Warendorf unsere Schule
besuchten. Vielleicht war ja ein
Kettenkarussellkind dabei!
Eine unserer Freundinnen sagte einmal: „Ach wäre
ich doch ein Kettenkarussellkind, dann könnte
ich immerzu mit dem Kettenkarussell durch die
Luft fliegen.“ In der Schule hielt sie dann
Ausschau nach den „Kirmeskindern“, die während
ihres Aufenthaltes in Warendorf unsere Schule
besuchten. Vielleicht war ja ein
Kettenkarussellkind dabei!
Schade, bald war unser Kirmesgeld zu Ende. Also
gingen wir auf den eigentlichen „Fettmarkt“.
Hier verkauften die Bauern ihre fetten Tiere. In
Gehegen und Käfigen sahen wir eine reiche
Auswahl von Schweinen, Schafen, Hühnern und
Kaninchen. An Eisenstangen waren Pferde, Kühe,
Kälber und Ziegen angebunden. Es wurde gehandelt
und gefeilscht und jeder Kauf mit einem Schnaps
begossen. Zur Stärkung gab es zwischendurch eine
deftige Portion Töttchen mit einem Brötchen.
Mutter Hagemeyer hatte vor der Metzgerei am
Wilhelmsplatz einen Töttchen- und
Knackwurststand aufgebaut.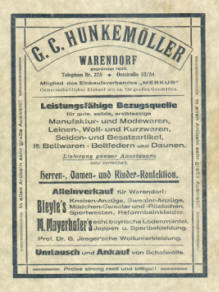
Für den Erlös des verkauften Viehs deckten sich
die Bauern sofort mit dem notwendigen Bedarf an
Hausrat und Winterbekleidung ein. Im Textilhaus
Hunkemöller an der Oststraße konnte man solide
Wintersachen für die ganze Familie und auch
Betten in guter Qualität einkaufen. Besonders
beliebt war die warme Bleyle-Unterwäsche in
unverwüstlicher Qualität. Kleine Jungen
verteilten überall in der Stadt Reklamezettel
und machten darauf aufmerksam, dass von der
Stadtmitte aus kostenlose Kutschfahrten zu
Hunkemöller am Osttor angeboten wurden.
Wir schoben uns mit viel Vergnügen und Drängeln
– das machte uns besonders viel Spaß - durch die
Menge auf der Münsterstraße. An der Ecke vor
Breuers Haus stand viele Jahre lang eine ältere,
wohlbeleibte Frau mit ihrer Drehorgel unter
einem Sonnenschirm. Sie sang mit kräftiger
Stimme moderne Schlager und altbekannte
Moritaten. Für 10 Pfennig verkaufte sie den Text
ihrer Lieder, damit die begeisterten Zuhörer
mitsingen konnten, was wir auch kräftig taten.
Daneben stand ein Entfesselungskünstler mit
seinem Eisenkäfig, in dem er sich anketten und
einsperren ließ. Zum Erstaunen der Zuschauer
konnte er sich jedes Mal wieder befreien.
Zu dieser Gruppe gehörten auch zwei Ringer, die
ihre Kräfte zeigten. An vielen Ständen in der
Münsterstraße blieben wir stehen, um die
lustigen Anpreisungen der Marktschreier hören.
 Unsere letzte Station war der Marktplatz. Hier
trafen wir unsere Mutter, die gerade bei ihrem
Kartoffelbauern 20 Zentner Kartoffeln für den
Winter bestellte. Ihren Bollerwagen hatte sie
schon hoch beladen mit Kappes-Köppen, die sie
von dem großen Wagen vor der Apotheke gekauft
hatte. Nun wussten wir: In den nächsten Tagen
beginnt die Sauerkrautproduktion. Die Tontöpfe
standen schon frisch gereinigt bereit, die
kleinen Leinentüchlein waren fertig
zugeschnitten. Für zwei Stunden mieteten wir
dann bei Borgmann in der Königstraße die
Sauerkrautschabe. Alle Kinder mussten beim
Hobeln helfen und beim Stampfen des Krautes im
Tontopf. „Es muss sich so viel Krautsaft bilden,
dass die obere Schicht Kraut im eigenen Saft
steht,“ schärfte uns unsere Mutter ein. War das
geschafft, deckten wir alles mit dem
Leinentüchlein ab und beschwerten die Krautmasse
mit einem blitzblanken Marmorstein. Nach drei
Wochen konnten wir das erste Sauerkraut essen.
Unsere letzte Station war der Marktplatz. Hier
trafen wir unsere Mutter, die gerade bei ihrem
Kartoffelbauern 20 Zentner Kartoffeln für den
Winter bestellte. Ihren Bollerwagen hatte sie
schon hoch beladen mit Kappes-Köppen, die sie
von dem großen Wagen vor der Apotheke gekauft
hatte. Nun wussten wir: In den nächsten Tagen
beginnt die Sauerkrautproduktion. Die Tontöpfe
standen schon frisch gereinigt bereit, die
kleinen Leinentüchlein waren fertig
zugeschnitten. Für zwei Stunden mieteten wir
dann bei Borgmann in der Königstraße die
Sauerkrautschabe. Alle Kinder mussten beim
Hobeln helfen und beim Stampfen des Krautes im
Tontopf. „Es muss sich so viel Krautsaft bilden,
dass die obere Schicht Kraut im eigenen Saft
steht,“ schärfte uns unsere Mutter ein. War das
geschafft, deckten wir alles mit dem
Leinentüchlein ab und beschwerten die Krautmasse
mit einem blitzblanken Marmorstein. Nach drei
Wochen konnten wir das erste Sauerkraut essen.
Das waren bei uns die Nachwirkungen vom
Fettmarkt.
Bilder: Archiv der Altstadtfreunde Warendorf und
Archiv Haunhorst
Die Autorin Eugenie Haunhorst geb. Göcke
wurde 1912 in Warendorf geboren und wuchs in
einer Lehrerfamilie mit vier Geschwistern auf.
Im Alter von 90 Jahren begann sie, Erinnerungen
aus ihrem Leben im Warendorf der 1920er Jahre
aufzuschreiben. Sie starb 2016 im Alter von 103
Jahren.
alle Rechte vorbehalten: Eugenie Haunhorst 2006
Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Mechtild Wolff, An der Kreutzbrede 7, 48231 Warendorf, Tel: 02581 2135
E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de
Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2023 (Impressum und Datenschutzerklärung)
