Wie waren das Abitur und die Schule vor 60
Jahren?
Erinnerungen an die „Schule von gestern“
1960 - 2020: 60 Jahre Abitur am Mariengymnasium Warendorf
von Mechtild Wolff
von Mechtild Wolff

Das alte Gebäude des Mariengymnasiums
60 Jahre Abitur - das ist wahrlich ein Grund zum Feiern. In all den
Jahren haben wir uns regelmäßig alle 5 Jahre getroffen und uns dadurch
nie aus den Augen verloren. Wie sagte unsere leider schon verstorbene
Klassenkameradin Ulline so treffend: Klassentreffen sind immer schön, da
braucht man keinem was vorzumachen, die kennen einen alle viel zu gut.
Über unsere gemeinsame Schulzeit haben wir schon viel geredet, viele
Dönekes erzählt und unsere Lehrer kolportiert mit all ihren Stärken und
Schwächen. Ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht über das Jahr 1951,
das Jahr, in dem wir „auf die Marienschule“ kamen. Wie sah es damals in
der Marienschule aus, der 2. Weltkrieg war ja erst sechs Jahre vorbei.
Welche dramatischen Jahre hatte die Schule hinter sich? Für uns damals
zehnjährige Schülerinnen waren die sechs Jahre Frieden eine lange Zeit
und der Krieg war weit weg, obwohl er im Alltag noch allgegenwärtig war.
Mir kam unser Lyzeum eigentlich ganz normal vor, alles lief geregelt und
hinter die Kulissen ließ man uns nie gucken.
Aber wie hatte die Marienschule die Kriegsjahre wirklich überstanden,
als die Pforten am 8. Dezember 1945 wiedereröffnet wurden? Der 8.
Dezember war damals noch als das Fest „Mariä Empfängnis“ in unserem
Bewusstsein verankert und wurde in der Marienschule als Patronatsfest
gefeiert. Der Tag begann mit einer Messfeier in der Laurentiuskirche und
danach versammelten sich alle 600 Schülerinnen im Treppenhaus der
Marienschule - man kann es sich heute kaum vorstellen - um einer
besinnlichen Ansprache der Direktorin zu lauschen und Marienlieder zu
singen und Gedichte vorzutragen.
Diesen Tag hatten sich die Lehrer 1945 ausgesucht, um die längsten
Ferien der Schulgeschichte zu beenden. Mit dem Einmarsch der
amerikanischen Truppen in Warendorf zu Ostern 1945 hatte auch die
Marienschule schließen müssen. Die Siegermächte wollten nicht nur die
bedingungslose Kapitulation, sie wollten auch den Nationalsozialismus an
der Wurzel ausrotten. Das Ziel war die Entnazifizierung. Der neue Geist
der Demokratie sollte in die Schulen einziehen. Alle Lehrer mussten sich
nun überprüfen lassen, ob sie unter der Herrschaft der
Nationalsozialisten mehr als bloße Mitläufer gewesen waren.
 Zuerst
schaute man sich die langjährige Direktorin Frau Dr. Maria Moormann
genau an. Sie war seit 1928 Leiterin der Marienschule und hatte dieselbe
zur Oberschule ausgebaut, sodass 1941 das erste Abitur
abgenommen werden konnte. In den NS-Jahren hatte sie mit weiblicher
Klugheit und Beharrlichkeit das christliche Fundament der Schule gegen
den braunen Ungeist verteidigt. Sie besaß sogar den Mut, mit einer
jüdischen Schülerin, die nach Südafrika emigriert war, einen
Briefwechsel zu führen. 1940 allerdings konnte sie nicht verhindern,
dass die Marienschule in „Justus-Möser-Schule“ umbenannt wurde. Das war
für sie sehr schmerzhaft, denn „Marienschule“ war nicht nur ein Name, es
war ein Programm. Weil Frau Dr. Moormann sich der NS Ideologie nicht
unterwerfen wollte, enthoben die Machthaber sie Ende 1944 ihres Amtes
und übertrugen die Leitung der Schule dem strammen Nationalsozialisten
Dr. Heinrich Donnermann. Er war der linientreue Direktor des alt
ehrwürdigen Gymnasium Laurentianum, das jetzt „Brun-Warendorp-Schule“
hieß. Zu seiner ständigen Vertretung am Lyzeum ernannte der
Oberpräsident die Studienrätin Anna Maria Kaesbach - irgendjemand musste
ja schließlich für die tägliche Schulleitungsarbeit vor
Ort sein. Und Arbeit gab es genug, der Krieg brachte einschneidende
Veränderungen. Schulgottesdienste waren ab sofort verboten, die
Turnhalle wurde für Getreidelagerung beschlagnahmt, nach Angriffen auf
Münster wurde eine Auffang-Stelle für bombengeschädigte Evakuierte
eingerichtet - jeder Tag brachte neue Überraschungen, Einschränkungen
und Schikanen seitens der Nationalsozialisten, denn eine nach wie vor
religiös ausgerichtete Schule war den Nazis ein Dorn im Auge.
Zuerst
schaute man sich die langjährige Direktorin Frau Dr. Maria Moormann
genau an. Sie war seit 1928 Leiterin der Marienschule und hatte dieselbe
zur Oberschule ausgebaut, sodass 1941 das erste Abitur
abgenommen werden konnte. In den NS-Jahren hatte sie mit weiblicher
Klugheit und Beharrlichkeit das christliche Fundament der Schule gegen
den braunen Ungeist verteidigt. Sie besaß sogar den Mut, mit einer
jüdischen Schülerin, die nach Südafrika emigriert war, einen
Briefwechsel zu führen. 1940 allerdings konnte sie nicht verhindern,
dass die Marienschule in „Justus-Möser-Schule“ umbenannt wurde. Das war
für sie sehr schmerzhaft, denn „Marienschule“ war nicht nur ein Name, es
war ein Programm. Weil Frau Dr. Moormann sich der NS Ideologie nicht
unterwerfen wollte, enthoben die Machthaber sie Ende 1944 ihres Amtes
und übertrugen die Leitung der Schule dem strammen Nationalsozialisten
Dr. Heinrich Donnermann. Er war der linientreue Direktor des alt
ehrwürdigen Gymnasium Laurentianum, das jetzt „Brun-Warendorp-Schule“
hieß. Zu seiner ständigen Vertretung am Lyzeum ernannte der
Oberpräsident die Studienrätin Anna Maria Kaesbach - irgendjemand musste
ja schließlich für die tägliche Schulleitungsarbeit vor
Ort sein. Und Arbeit gab es genug, der Krieg brachte einschneidende
Veränderungen. Schulgottesdienste waren ab sofort verboten, die
Turnhalle wurde für Getreidelagerung beschlagnahmt, nach Angriffen auf
Münster wurde eine Auffang-Stelle für bombengeschädigte Evakuierte
eingerichtet - jeder Tag brachte neue Überraschungen, Einschränkungen
und Schikanen seitens der Nationalsozialisten, denn eine nach wie vor
religiös ausgerichtete Schule war den Nazis ein Dorn im Auge.
Nun aber zurück zum Neubeginn nach Kriegsende:
Den Siegermächten wurde schnell klar, dass an der untadeligen
Gesinnung der Direktorin Dr. Moormann kein Zweifel bestehen konnte.
Darum wurde sie unmittelbar nach Kriegsende von den Alliierten wieder
als Direktorin des Lyzeums eingesetzt und damit beauftragt, wieder einen
normalen Schulunterricht aufzubauen. Schnell wurde der dringlichste
Wunsch der Direktorin erfüllt: Das Lyzeum bekam seinen Namen
„Marienschule“ zurück, den ihr die Gründungsväter 1910 gegeben hatten.
Dr. Heinrich Donnermann bestand die Entnazifizierung nicht, wurde
seines Amtes enthoben und musste den Schuldienst quittieren. Der
Volksmund sagte damals: Er hat keinen Persilschein bekommen.
Bürgermeister Heinrich Temme, Schulrat Josef Pelster und die
Direktorin Dr. Maria Moormann waren nun mitverantwortlich für die
Entnazifizierung der Lehrer. Die Beurteilung des Kollegiums war insofern
nicht schwierig, als der christliche Geist der Schule auch in der NS
Zeit nicht erschüttert werden konnte und die Direktorin ihr Kollegium
genau kannte und bestehende Bedenken überzeugend ausräumen konnte. Wie
schwierig das manchmal war, zeigt der Fall der Musiklehrerin Margarete
Ernst (1897-1977). Diese hatte 1941 auf Aufforderung der
Ortsfrauenschaftsleiterin eine Musikgruppe der Ortsfrauenschaft
Warendorf gegründet und geleitet. Frau Dr. Moormann konnte den
Ortskommandanten davon überzeugen, dass eine Ablehnung dieses Wunsches
für die junge Musiklehrerin damals
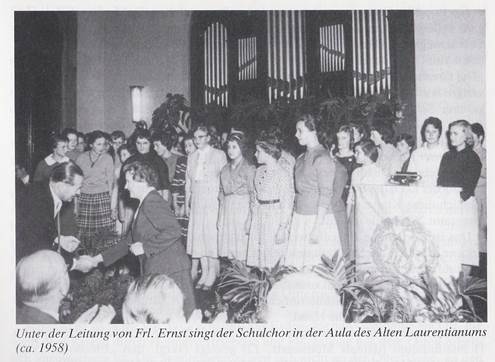 unmöglich
gewesen war, denn sie hatte gerade erst ihre Anstellung bekommen. Die
Direktorin konnte glaubhaft versichern, dass Fräulein Ernst kein
nationalsozialisti-sches Liedgut im Unterricht gesungen hatte, sondern
schöne deutsche klassische und neuere Musik mit den Schülerinnen
gepflegt hatte. So wurde dann auch Frl. Margret Ernst am 5.12.1945
erfolgreich entnazifiziert.
unmöglich
gewesen war, denn sie hatte gerade erst ihre Anstellung bekommen. Die
Direktorin konnte glaubhaft versichern, dass Fräulein Ernst kein
nationalsozialisti-sches Liedgut im Unterricht gesungen hatte, sondern
schöne deutsche klassische und neuere Musik mit den Schülerinnen
gepflegt hatte. So wurde dann auch Frl. Margret Ernst am 5.12.1945
erfolgreich entnazifiziert.
Bevor die Schule wiedereröffnet werden konnte, mussten strenge
Voraussetzungen erfüllt werden: Der Geschichtsunterricht wurde vorerst
untersagt. Auch der Deutschunterricht war zunächst verboten, erst
mussten brauchbare Lehrbücher und Lektüren zusammengestellt werden. An
neue Lesebücher war wegen der Materialknappheit gar nicht zu denken,
darum wurden Lehrbücher erlaubt, die vor 1933 gedruckt worden waren. Aus
dem vorgesehenen Lesebuch „Von deutscher Art, ein Lesebuch für Mädchen“
wurden alle Lesestücke herausgeschnitten, die an das Großdeutsche Reich
erinnerten, wie z.B. „Bilder aus dem deutschen Danzig“, oder „Eine
deutsche Familie in Russland“ oder „Das Banater Schwabenlied“.
Ende November 1945 waren dann alle Hürden genommen und den Warendorfer Gymnasien wurde als einigen der ersten in Westfalen die Genehmigung zur Wiedereröffnung erteilt. Das Lehrerkollegium setzte sich aus den altbekannten Lehrerinnen und einem einzigen Lehrer zusammen. Der Lehrer Adam Wacker (1889-1959) war schon seit 1928 an der Marienschule und war wegen seines Alters im Krieg nicht eingezogen worden.
 |
 |
| Theo Pröpper | Frl. Bracht, Frl. Kaesbach, Frl. Schütt, Frl. Kampelmann, Frl. Merkelbach, Herr Wacker |
Er wurde pensioniert, als wir in der Sexta waren. Seit 1939 gab es
einen zweiten Lehrer im Kollegium: Theodor Pröpper. Er kam aber erst
1946 aus der Gefangenschaft zurück. Studienrat Pröpper war ein wahrer
Segen für die reine Mädchenschule, denn so konnten wir auch mal einen
Lehrer erleben. Er war unser Englischlehrer und wir erinnern uns noch
heute mit Vergnügen daran, dass er die Kreide nicht nur dafür benutzte,
uns den AcI an der Wandtafel zu erklärte, sondern auch, um mit einem
gezielten Wurf Schülerinnen aus dem Schulschlaf zu wecken. 1955
wechselte er zu unserem Bedauern zum Laurentianum herüber. Der Schule
hinterließ er eine gut geführte Schulchronik, in der alle wichtigen
Schulereignisse für die Nachwelt festgehalten waren.
Dann war da Frl. Schütt (1892-1954), die schon seit 1925 an der
Marienschule war. Ich erinnere mich noch gut daran, dass sie 1954 in
Amersfoort/Holland auf einer Klassenfahrt mit dem Fahrrad tödlich
verunglückte.
 |
 |
 |
 |
| Theresia Kampelmann | Dr. E. Hufnagel | Margarete Heese | Dr. J. Hornig |
Zu dem Kollegium aus der Gründungszeit der Schule gehörten auch
Theresia Kampelmann (1890-1985), die 1948 Direktorin der Schule wurde
und Maria Heukmann (1890-1969), unsere Religions-lehrerin, die schon
seit 1911 an der Schule war.
Anna Maria Kaesbach unterrichtete schon seit 1934 an der Schule
Mathematik, Erdkunde, Physik und Nadelarbeiten. Sie hat versucht, auch
uns Mathe beizubringen, was ihr nicht bei allen gelungen ist. Dafür
konnte sie umso spannender von ihren Reisen erzählen und war eine sehr
weltoffene Lehrerin. Viele Jahre lang war sie eine der wenigen Frauen im
Rat der Stadt Warendorf, was uns sehr imponierte.
Seit 1943 war Frau Dr. Elisabeth Hufnagel (1896-1990) in Warendorf.
Sie war vielleicht die schillerndste Persönlichkeit im Kollegium und hat
auch unsere Schullaufbahn entscheidend geprägt. 1896 geboren, wurde sie
1916 zuerst Volksschullehrerin. Diese Ausbildung hatte sie noch auf dem
Lehrerseminar absolviert. Das reichte ihr aber nicht, darum legte sie
1923 das Abitur ab und studierte in Münster Deutsch, Englisch und
Französisch, ein recht ambitionierter Fächerkanon. 1934 sollte die junge
Studienassessorin die Leitung einer nationalsozialistischen Frauenschule
in Münster übernehmen. Dem Nationalsozialismus wollte sie aber nicht
dienen und zog es vor, in die Volksschule zu gehen, obwohl sie eine
akademische Ausbildung hatte. Ihre Tätigkeit in Everswinkel und Münster
nutzte sie zur Erstellung einer Promotion mit dem Thema: „Aus der
Sprache einer Familie. Ein Beitrag zur Sprachinhaltsforschung.“ 1942
wurde sie promoviert. Als 1943 die meisten münsteraner Schulen
geschlossen wurden, bekam Dr. Elisabeth Hufnagel eine Stelle an der
Marienschule in Warendorf, allerdings nur für ein Jahr auf Bewährung mit
dem Gehalt einer Mittelschullehrerin, denn bei den Nazis stand sie immer
noch auf der schwarzen Liste. Aber die Marienschule brauchte dringend
Lehrkräfte, da die Anzahl der Schülerinnen wegen der vielen Evakuierten
aus den bombengeschädigten Großstädten von normalerweise um die 400 auf
jetzt 810 Mädchen angewachsen war. Da konnte es sich auch das NS Regime
nicht erlauben, auf Frau Dr. Hufnagel zu verzichten. Als mit Kriegsende
auch die Marienschule geschlossen wurde, engagierte die Militärregierung
Dr. Hufnagel als Dolmetscherin. Das war für sie eine sehr spannende
Erfahrung, von der sie später gern ihren Schülerinnen erzählte. Mit der
Neueröffnung der Marienschule im Dezember 1945 bekam sie endlich ihre
Anstellung als Studienrätin. Schon 1948 wurde sie Mentorin der
neusprachlichen Referendare. Uns allen ist „Frau Dr.“ in lebhafter
Erinnerung und wir könnten mit Geschichten aus ihrem amüsanten
Unterricht ganze Bücher füllen. 1962 ging sie in den Ruhestand und lebte
bis 1990 in Münster.
 |
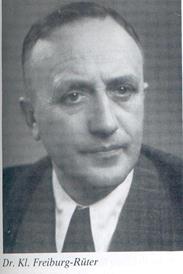 |
 |
|
| Rosa Senger | Dr. Kl. Freiburg-Rüter | Marianne Köster |
Eine ganz wichtige Kollegin war Frl. Rosa Senger. Sie war
eine brillante Mathe-Lehrerin und zu unserer Zeit stellvertretende
Schulleiterin, verantwortlich für die Finanzen und den Stundenplan und
eine immer freundliche Helferin der Not.
Nach seiner Vertreibung aus Schlesien kam 1946 unser geistlicher Rat
Dr. Josef Hornig (1900-1980) als Religionslehrer und geistlicher Berater
an die Schule und ab 1948 gehörte unsere gestrenge Biologie-Lehrerin
Frl. Heese zum Kollegium.
 1949
kam Frau Müller-Temme, durch die wir um die Erfahrung reicher wurden,
dass eine Lehrerin auch Kinder bekommen konnte. Frau Müller-Temme war
eine Pionierin wider Willen, sie wollte einfach nur ihren Traumberuf als
Sportlehrerin ausüben. Aber sie war verheiratet und nur weil
Lehrpersonen so händeringend gesucht wurden, sah man über diesen „Makel“
geflissentlich hinweg. Allerdings musste sie sich für fünf Jahre
verpflichten, was so viel hieß wie: Fünf Jahre lang keine Kinder, denn
eines war ganz klar: Schule und Kinder, das war nicht vereinbar, das
hatte es an der Marienschule noch nie gegeben, denn alle Lehrerinnen
waren unverheiratet. Als nach sieben Jahren ihre erste Tochter geboren
wurde, beglückwünschte Frau Direktorin Kampelmann die junge Mutter zwar,
teilte ihr aber im gleichen Zuge mit, dass eine Bewerbung für die ihr
eigentlich zustehende Studienratsstelle nicht mehr in Frage komme. Die
Direktorin konnte sich nicht vorstellen, dass Frau Müller-Temme als
Mutter eines Kindes im Schuldienst bleiben würde. Trotz der harten
Bedingungen, Mutterschutz gab es nur 6 Wochen vor und nach der Geburt,
blieb Frau Müller-Temme im Schuldienst und bekam noch zwei weitere
Kinder. Pausieren oder die Stundenzahl reduzieren hätte den Verlust des
Beamtenstatus zur Folge gehabt. Wie gut, dass die Großmutter mit im
Haushalt lebte und für die Kinder sorgte.
1949
kam Frau Müller-Temme, durch die wir um die Erfahrung reicher wurden,
dass eine Lehrerin auch Kinder bekommen konnte. Frau Müller-Temme war
eine Pionierin wider Willen, sie wollte einfach nur ihren Traumberuf als
Sportlehrerin ausüben. Aber sie war verheiratet und nur weil
Lehrpersonen so händeringend gesucht wurden, sah man über diesen „Makel“
geflissentlich hinweg. Allerdings musste sie sich für fünf Jahre
verpflichten, was so viel hieß wie: Fünf Jahre lang keine Kinder, denn
eines war ganz klar: Schule und Kinder, das war nicht vereinbar, das
hatte es an der Marienschule noch nie gegeben, denn alle Lehrerinnen
waren unverheiratet. Als nach sieben Jahren ihre erste Tochter geboren
wurde, beglückwünschte Frau Direktorin Kampelmann die junge Mutter zwar,
teilte ihr aber im gleichen Zuge mit, dass eine Bewerbung für die ihr
eigentlich zustehende Studienratsstelle nicht mehr in Frage komme. Die
Direktorin konnte sich nicht vorstellen, dass Frau Müller-Temme als
Mutter eines Kindes im Schuldienst bleiben würde. Trotz der harten
Bedingungen, Mutterschutz gab es nur 6 Wochen vor und nach der Geburt,
blieb Frau Müller-Temme im Schuldienst und bekam noch zwei weitere
Kinder. Pausieren oder die Stundenzahl reduzieren hätte den Verlust des
Beamtenstatus zur Folge gehabt. Wie gut, dass die Großmutter mit im
Haushalt lebte und für die Kinder sorgte.
Unser langjähriger Physik- und Chemie-Lehrer Walter Koch (1912-1983)
kam nach Krieg und Gefangenschaft und fünf Jahren Laurentianum genau wie wir 1951 an die Marienschule und
blieb bis 1961. Aus gesundheitlichen Gründen ging er dann an die
Europaschule in Varese/Italien.
fünf Jahren Laurentianum genau wie wir 1951 an die Marienschule und
blieb bis 1961. Aus gesundheitlichen Gründen ging er dann an die
Europaschule in Varese/Italien.
Und erst 1959 kam Dr. Clemens Freiburg-Rüter (1905-) mit den Fächern
Deutsch, Englisch und Französisch zu uns. Noch damals war er
traumatisiert von seiner Kriegs- und Gefangenschafts-Zeit, mit der er uns viele Schulstunden lang bestens unterhielt.
Ja, und nicht zu vergessen unsere
Oberstufen-Klassenlehrerin Marianne Köster. Als sie 1956 als neue
Direktorin an unsere Schule kam, mussten wir uns von der unnachgiebig
strengen, immer korrekten und eleganten Erscheinung der Direktorin
Kampelmann auf eine kleine, unscheinbare Direktorin Köster umgewöhnen,
die aus dem Ruhrgebiet, aus Datteln, kam und einen eher direkten Umgang
pflegte. Anfänglich fanden wir das sehr erfrischend, zumal sie in ihrer
Einführungsrede unsere Herzen gewonnen hatte, als sie die Schülerinnen
der Frauenoberschule als gleichwertig neben die Lateinschülerinnen
stellte. Dieser Geist war neu an der Marienschule und gefiel uns
natürlich sehr. Ihre wirklichen Stärken hatte sie aber wohl nicht in der
Prägung der Schülerinnen, sondern in ihrer Zähigkeit, mit der sie einen
Schulneubau für die Marienschule forderte, den die Stadt Warendorf wegen
der großen finanziellen Belastung zu vermeiden versuchte. Die
Grundsteinlegung an der Von-Ketteler-Straße haben wir noch miterlebt und
Heidrun durfte mit einem Gedicht brillieren. Zu Ostern 1961 wurde der
Neubau eingeweiht, unser Abitur war das zweitletzte im alten
Marienschulgebäude an der Kurzen Kesselstraße. Dieser Neubau war
wahrlich kein Luxus, die alte Marienschule war viel zu klein geworden.
Wir haben unsere letzten Schuljahre in einem winzigen Klassenraum auf
dem Dachboden zugebracht, direkt neben dem Kartenzimmer. Die wackelige
Holztreppe dürfte heute nicht einmal mehr von einer Maus benutzt werden.
Aber wir haben uns da oben sehr wohl gefühlt - weit vom Schuss, das
hatte entscheidende Vorteile.
Nun aber wieder zurück zum 8. Dezember 1945:
Als alle Lehrer sich schriftlich verpflichtet hatten, „keine
nationalsozialistischen und militärischen Gedanken zu lehren“, konnte
die feierliche Wiedereröffnung der beiden Gymnasien im alten
Sparenbergschen Kino an der Freckenhorsterstraße
stattfinden. Das Laurentianum bestritt die Orchesterstücke und die
Marienschülerinnen sangen im Chor. Die Einladung hatte die
Besatzungsmacht in Englisch auf ein DinA4 Blatt getippt, der
Bürgermeister und die Schuldirektoren hielten bewegende Reden.
Der Unterricht hatte schon am 3. Dezember begonnen, der Schulbeginn
mit einer Messe in der Alten Pfarrkirche war in den Straßen der Stadt
durch den städtischen Ausrufer „ausgerufen“ worden. Nun war aber das
Marienschulgebäude noch von den Alliierten besetzt, darum mussten die
Schülerinnen noch bis August 1946 in die Kardinal-von-Galen-Schule an
der Klosterstraße. Da herrschte natürlich drangvolle Enge, sodass in
Schichten unterrichtet wurde und für die Unter- und Mittelstufe konnte
nur an 2-3 Tagen in der Woche Unterricht erteilt werden. Da es nicht
genügend Sitzgelegenheiten gab, mussten sich die Schülerinnen ihren
eigenen Stuhl mitbringen. Viele andere Gebäude und Keller in der Stadt
waren mit Behelfs-Klassenräumen belegt. Akten und Schulunterlagen gab es
fast keine, das war alles entweder von der Besatzungsmacht verheizt
worden oder von den Insassen der Russen- und Polenlager gestohlen oder
verheizt worden. Auch die physikalischen, chemischen und biologischen
Sammlungen sowie das Kartenmaterial waren verschwunden.
Mit viel Idealismus wurde nun jede Möglichkeit für Unterricht
genutzt. Die Weihnachtsferien endeten schon am 28. Dezember und die
Osterferien wurden auf sieben Tage gekürzt. Die Lehrer trugen die äußere
Not des Schulalltages mit Gelassenheit in der Hoffnung auf bessere
Zeiten. Das Wichtigste war, dass die geistige Not ein Ende hatte. Trotz
all der Einschränkungen hielt man an den alten Traditionen fest. Auch
das jährliche, oft recht anspruchsvolle Theaterstück für die
Abiturientinnen übten die Unterprimanerinnen wieder ein und führten es
unter großem Jubel im Kolpinghaus auf. Auf Zucht und Ordnung wurde
unverändert streng geachtet. So wurden zwei Schülerinnen 1947 mit der
Androhung der Verweisung von der höheren Schule bestraft, weil sie am 6.
Dezember als Nikolaus und Knecht Ruprecht verkleidet Schabernack in zwei
Klassen getrieben hatten.
Noch bis 1953 gab es dreimal im Jahr Zeugnisse, zu den
Sommerferien, zu Weihnachten und zu Ostern.
Ja, auch die Nachkriegsjahre waren eine riesige Kraftanstrengung und
weil sie so mutig bewältigt wurde, fanden wir 1951 eine ganz normale
Schule vor und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals über all diese
Schwierigkeiten gesprochen wurde. Aber vielleicht hätten wir auch gar
nicht zugehört, genau so wenig, wie wir Dr. Freiburg-Rüters
Kriegserzählungen einordnen konnten. Wir waren eben ganz normale
Schülerinnen, bei denen das Lernen nicht immer oberste Priorität hatte.
Aber stolz waren wir, als wir zu Ostern 1960 das Abiturzeugnis in den
Händen hielten. Und wie haben wir uns gesonnt, als wir uns nach der
mündlichen Abiturprüfung, die so manche Überraschung gebracht hatten, im
Treppenhaus aufstellen durften und von Geschwistern und Freunden
bejubelt wurden.
 |
| unsere mündliche
Abitur-Prüfungsgruppe 1960 |
Mechtild Wolff 2020
Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03
E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de
Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden
