Auf der Emsinsel darf nicht gebaut werden!
Brief an Herrn Pesch, Stadt Warendorf
von Walter Schmalenstroer (1. 8. 2021)
Sehr geehrter Herr Pesch,
vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Mail vom 22. Juli 2021. Ich hatte
Ihnen bezüglich der Hochwasserrisiken in Warendorf geschrieben, weil ich
davon ausgehe, dass für Sie und auch für alle politisch Verantwortlichen
in Warendorf es selbstverständlich ist, sich für Warendorf einzusetzen
und auch Gefahren von unserer Stadt abzuwenden. So ist eine gemeinsame
Zielrichtung vorhanden. Das ist gut so und erleichtert das Gespräch.
Dies gilt auch für die Verbesserung der Hochwassersicherheit in bzw. für
Warendorf. Gerne nehme ich Ihre Einladung an, mich mit Anregungen, aber
auch mit Bedenken einzubringen. Nehmen Sie bereits diesen Brief als
Beitrag zu diesem Prozess.
Über die Wege zum Ziel Hochwasserschutz gibt es unterschiedliche
Vorstellungen. Dies gilt insbesondere für die Planungen zu „Neuen Ems“.
Auch wenn der Planfeststellungsbeschluss für den westlichen Teil der
„Neuen Ems“ rechtskräftig und es auch politisch so beschlossen ist,
stellen sich viele Fragen:
1. Grundsätzliche Aspekte: ich möchte zunächst schlaglichtartig unter
Zitierung aktueller Artikel grundsätzliche Fragen ansprechen: „Wir
werden Maßnahmen implementieren müssen, um Hochwasser zu verhindern, zum
Beispiel Entsiegelung, ….. oder Raum für die Flüsse. Wir können uns
aktiv schützen, mit Deichen und Mauern zum Beispiel. Aber man kann eben
auch eine andere Strategie fahren, um sich anzupassen, zum Beispiel ….
generell eine darauf ausgelegte Bauweise. Ein ganz wichtiger Aspekt bei
den Maßnahmen ist ganz sicherlich die Raumplanung. Sie ist der
effektivste Schutz vor Hochwasserkatastrophen. Denn der Fluss oder das
Meer sind nicht die Bösen, sondern die Leute bauen dort, wo der Fluss
einst ausgeufert ist. Sie haben ihn auch oft verengt.
(HOCHWASSERSCHUTZ»Verhindern, schützen, anpassen« Lars Fischer,
www.spektrum.de/news/hochwasser-verhinder n-schuetzen-anpassen/1899532
artikel vom 28.7.2021 abgerufen am 28.7.2021) „In den letzten Jahren und
Jahrzehnten wurde – zu Recht – kritisiert, dass viele Flüsse und sogar
Bachläufe in Mitteleuropa in ein enges Korsett gezwängt wurden: Gewerbe-
und Wohnsiedlungen wurden ebenso wie Straßen in ehemaligen
Auenlandschaften gebaut, die zum natürlichen Überflutungsbereich der
Fließgewässer gehören. Stattdessen errichteten die Wasserbaubehörden
Dämme, die ebenjene Überschwemmungen verhindern sollten, aber das
Problem durch erhöhte Fließgeschwindigkeiten einfach nur flussabwärts
verlagerten.“ (FLUTKATASTROPHE Kein hausgemachtes Hochwasser von Daniel
Lingenhöhl Artikel vom 03.06.2013
www.spektrum.de/kolumne/flutkatastrophe-hochwasser-in-deutschland/
1197092 abgerufen am 28.7.2021) Berücksichtigt man diese
Ausführungen, die offenbar den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft
darstellen, würde dies konkret für Warendorf bedeuten: die
Brinkhausbrache sollte nach Abbruch der nicht verwendbaren
Industriebauten entsiegelt werden; dabei würde gleichzeitig ein
Naturraum entstehen, der im Falle eines Hochwassers als Ausgleichsfläche
dienen könnte. Vorhandene Rasen und Baumbestände würden dabei kaum
größere Schäden erleiden. Sinnvoll wäre vor allem eine Raumplanung, die
verhindert, dass dort neu gebaut wird, wo der Fluss Schaden anrichten
kann. Professor Stefan Greiving vom Institut für Hochwasserplanung der
Technischen Universität Dortmund geht sogar soweit, dass er beim
Hochwasserschutz im Sinne von Risikovorsorge nicht nur eine Bebauung in
Risikobereichen ablehnt, sondern sogar in bestimmten Fällen sogar eine
„Entsiedelung“ von gefährdeten Flächen für notwendig hält. Es ist
notwendig, hier auf Experten zu hören. Die grundsätzliche Aussage lautet
insgesamt: in Risikogebieten darf nicht neu gebaut werden.
2. Konkrete Fragen an das Konzept der „Neuen Ems“: Die aktuelle
Situation bei Hochwasser sieht so aus, dass anströmende Wasser (durch
Pfeile dargestellt) durch Emssee und Flusslauf an der Stadt Warendorf
vorbei auf den Lohwall und die dahinter liegenden Wiesen und Äcker
geleitet werden (s. Bild):
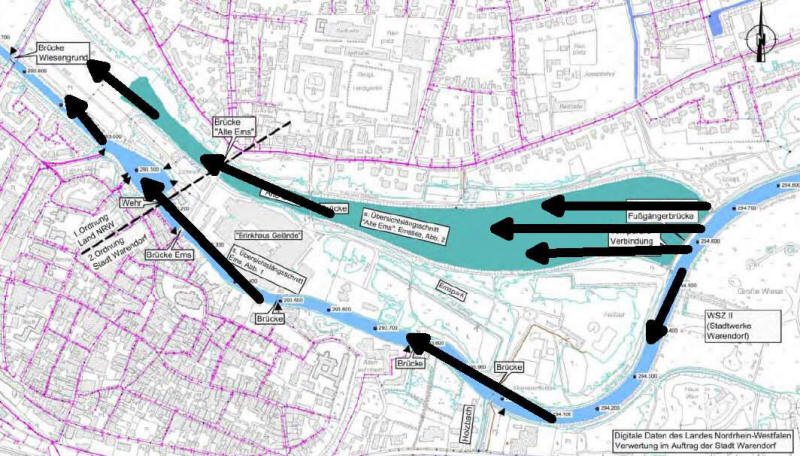
Bei Extremhochwassern stellen sich zu den Planungen der „neuen Ems“
viele Fragen:
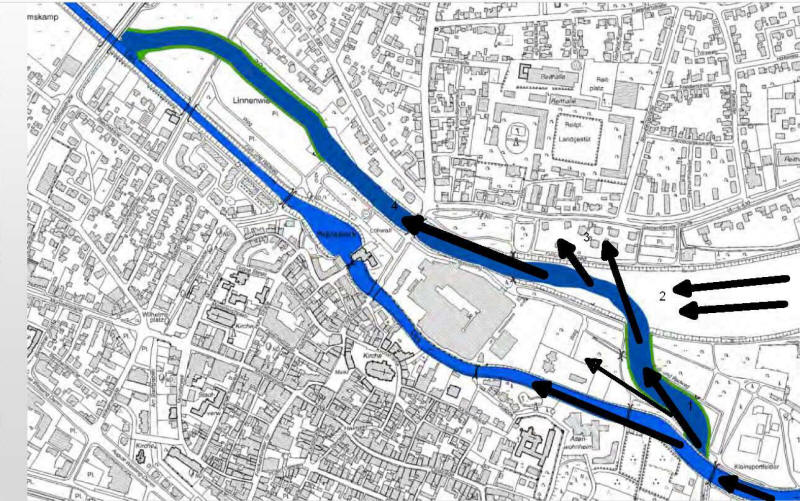
An Stelle 1: Wird bei (extrem) stark anströmendem Wasser an der
Abzweigstelle das Wasser wirklich brav den vorgesehenen Weg nehmen oder
(was wahrscheinlicher ist) wird der Wasserstrom nicht versuchen, auch
die durch den kleinen Pfeil angedeutete Richtung zu nehmen? Vermutlich
ist das Brinkhausgelände im Extremfall nicht wirklich geschützt.
Zu Stelle 2: Was geschieht bei Extremhochwasser, wenn sich der reißende
Durchfluss durch den Emssee und die starken Strömungen durch die „neue
Ems“ vereinen? Die Wassermengen, die den Emssee durchfluten, reichen
aktuell für den Durchfluss bei stärkeren Hochwassern aus. Was geschieht,
wenn dieser Durchfluss und das Wasser der „Neuen Ems“ sich vereinen?
Dann entsteht doch wohl eine Superwelle, die insbesondere die Häuser auf
der Seeseite der Milter Straße in Mitleidenschaft ziehen werden(4). Das
Emstal in diesem Bereich hat nur einen gegebenen und nicht beliebig
vergrößerbaren Querschnitt und kann nur ein bestimmtes Wasservolumen
schadlos abführen. Leitet man Wasser aus dem aktuellen Emslauf in
Richtung Emssee um, wird dieses in Kombination mit dem den Emssee
flutenden Wassern in andere Bereiche gelangen. Bei extremen Hochwasser
wird dann der Bereich von Sassenberger und Milter Straße durch
Hochwasser betroffen sein. Reicht der Durchlass der Brücke über den
Emssee aus, ein auf diese Weise gesteigertes Hochwasser ohne einen
Rückstau abführen zu können? Sind dann Schäden an der Brücke zu
befürchten oder ist gar ein Rückstau mit kaum kalkulierbaren Folgen
möglich? Ist der gewünschte Schutz der Emsinsel durch Überschwemmung
anderer Gebiete erkauft? Das kann doch keiner wollen.
Zu Stelle 3: Noch problematischer wird dies durch folgenden Aspekt: Bei
der Vereinigung der Durchflüsse von Emssee und „Neuer Ems“ kann es bei
Hochwassersituationen auch zu unkontrollierbaren Verwirbelungen und
Strömungen an Stelle 3 kommen. Welche Gewalt werden diese Wirbel
erzeugen? Werden dann Wasser die Häuser an der Sassenberger Straße und
der Sophienpark (evtl. sogar bis hin zum Landgestüt) betroffen sein? Im
Falle eines Schadens könnten hier Schadensersatzforderungen der Anlieger
fällig werden. Müssen dann zur Verhinderung solcher Schäden im Bereich
des Emssees Deichanlagen errichtet werden, was nicht der Idee eines
städtischen Erholungsgebietes (Gartenschau!!) entspräche? Sind solche
Eindeichungen evtl. sogar auch ohne Hochwasser notwendig? Schließlich
bildet die nördliche Seite des Emssees ja den Prallhang, auf den die
Fluten der „Neuen Ems“ auftrifft. Die ständige Strömung der „Neuen Ems“
könnte die Nordseite des Emsseeparks und den Sophienpark gefährden.
Fragen über Fragen! Je intensiver ich mir die Planungen anschaue, desto
fragwürdiger wird das ganze Projekt. Lassen sich die hier gestellten
Fragen konkret und sachlich beantworten? In der Hydrologie werden
hydrodynamische Computermodelle verwendet; noch konkreter ist der Bau
eines Landschaftsmodells, das Wasserflüsse im „Miniaturmaßstab“
untersuchen lässt. Wäre es nicht angebracht, hier sachlich und nüchtern
ohne politische und wirtschaftliche Vorgaben zu untersuchen? Besser
vorher prüfen als später den Schaden zu haben.
In meinem Brief bin ich auf den Aspekt Klimaschutz und Klimaanpassung
nur am Rande eingegangen, sondern ich habe den Focus auf den
Hochwasserschutz und die „Neue Ems“ gerichtet. Ich gehe allerdings davon
aus, dass die Veränderungen des Klimas erhöhte Anstrengungen im
Hochwasserschutz notwendig machen und dass diese Veränderungen es
notwendig machen, vorhandene Planungen in Frage zu stellen und sachlich
zu überprüfen. Die Wiedernutzung heute bereits versiegelter Flächen im
Bereich der Industriebrache Brinkhaus stellt doch wiederum eine
Versiegelung dar und ist wohl kaum ein Beitrag zum Klimaschutz. Mit
freundlichem Gruß
Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03
E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de
Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden
